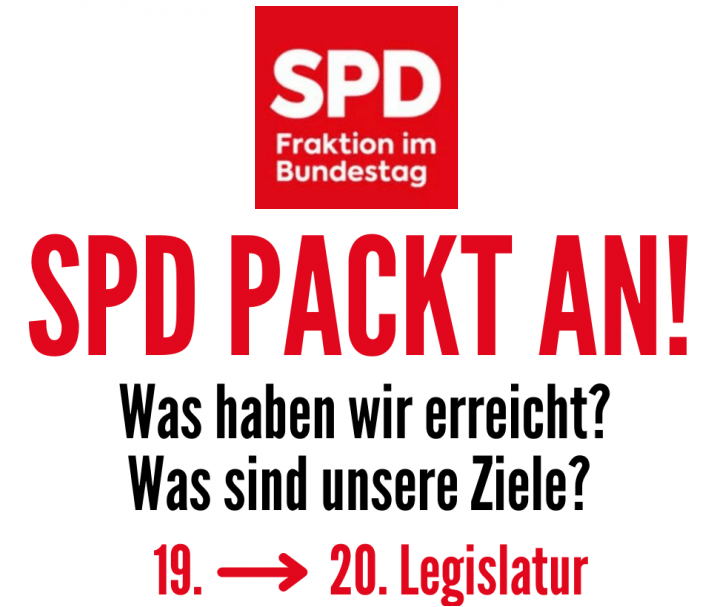Gesundheit für Alle!
 Vielen Menschen, die noch nicht unter einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung leiden, ist unbekannt, welche Schwierigkeiten und Umstände damit verbunden sind. Dabei kann jeden Tag etwas geschehen. Für Sie habe ich eine sehr umfassende Darstellung zur Veranstaltung „Gesundheit für alle“ geschrieben. Bitte stöbern Sie einmal darin rum. Sie werden erstaunt sein, worum mensch sich alles kümmern muss.
Vielen Menschen, die noch nicht unter einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung leiden, ist unbekannt, welche Schwierigkeiten und Umstände damit verbunden sind. Dabei kann jeden Tag etwas geschehen. Für Sie habe ich eine sehr umfassende Darstellung zur Veranstaltung „Gesundheit für alle“ geschrieben. Bitte stöbern Sie einmal darin rum. Sie werden erstaunt sein, worum mensch sich alles kümmern muss.
Fakt ist: Der individuelle Gesundheitszustand beeinflusst die subjektive Lebensqualität und auch die gesellschaftlichen Teilhabechancen. Fakt ist auch: Menschen mit Behinderungen haben einen besonderen Bedarf an gesundheitlichen Versorgungsleistungen. Arztpraxen und Krankenhäuser sind aber oft nicht barrierefrei. Fakt ist weiterhin: In vielen Gesundheitsberufen existieren „Barrieren in den Köpfen“. Wie inklusiv ist also unser Gesundheitswesen wirklich? Mit dieser Frage setzte sich die „Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv - Menschen mit Behinderungen in der SPD“ in einer sehr gut besuchten Veranstaltung am 09. September im Nachbarschaftsheim Schöneberg auseinander.
Karin Sarantis-Aridas, Vorsitzende der AG Selbst Aktiv Berlin, forderte alle Anwesenden zum Einmischen und zum Mitmischen in der Politik auf. Nur so könne eine inklusive Gesellschaft, in der eine gleichberechtigte Teilhabe von Anfang an gilt, geschaffen werden. Eine gute gesundheitliche Versorgung ist dabei eine zentrale Forderung. Obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit festschreibt, existieren weiterhin zahlreiche Barrieren wie Treppenstufen vor den Arztpraxen, unzureichend barrierefrei gebaute Reha-Einrichtungen, mangelnde Assistenz im Krankenhaus, fehlende Kommunikation für Hörbehinderte, fehlendes Wissen auf Seiten der ÄrztInnen hinsichtlich spezifischer Zusammenhänge von Gesundheit und Behinderung.
Mit einer Behinderung lebende Menschen sind nicht automatisch krank
Eine Medizinerin, die sich intensiv mit „Gute Medizin für Menschen mit geistiger Behinderung“ auseinandersetzt, ist Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust, Bundesgeschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.. In verständlicher Sprache wurde auch ihrerseits bestätigt: Das Gesundheitswesen ist viel zu wenig auf die Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst.  Was kann mensch für eine gute Medizin für Menschen mit geistiger und anderen Behinderungen tun?
Was kann mensch für eine gute Medizin für Menschen mit geistiger und anderen Behinderungen tun?
Mit einer Behinderung lebende Menschen sind nicht automatisch krank. Manchmal führt Krankheit zu Behinderung, zum Beispiel beim Schlaganfall, manchmal gibt es Krankheiten, die sich bei spezifischen Behinderungsformen häufen, zum Beispiel kommt es bei einer halbseitigen Lähmung öfter zu einer Wirbelsäulenverkrümmung.
Menschen mit einer Behinderung müssen wegen der Begleit- und Folgekrankheiten häufiger zur ÄrztIn. Selbstverständlich gibt es viele behinderungsunabhängige Krankheiten, zum Beispiel Durchfall oder ein Magengeschwür. Menschen mit Behinderungen sind aufgrund ihres Bedarfs an Hilfsmitteln wie Rollstuhl oder Heilmitteln oder verschiedenen Therapien auch häufiger bei verschiedenen ÄrztInnen in Behandlung. Wichtig ist hier der Austausch untereinander: Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Wie erfährt der eine vom anderen über die jeweils verschriebenen Medikamente?
Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung können häufig nicht selber sagen „Ich muss zum Arzt“, es muss jemand anderes auf die Idee kommen, „wir sollten mal zum Arzt“. Wichtig hier auch die notwendige Dokumentation über die verschiedenen Vorbehandlungen, wichtig auch die Menschen, die die gesetzlichen BetreuerInnen sind, und die BetreuerInnen in den Einrichtungen. Die BetreuerInnen sind für Menschen mit geistiger Behinderung ganz wesentlich, da diese als PatientInnen keine Beschreibung der Krankheitssymptome geben können. BetreuerInnen müssen gut beobachten. Es muss aber auch besonders gut untersucht werden.
Ist die Kommunikation erschwert, ist es schwieriger, die richtige Diagnose zu finden - zumal Krankheitsanzeichen bei Menschen mit Behinderung häufig auch anders bzw. nicht so deutlich sind. Beispiel Lungenentzündung: Die gängigen Anzeichen für eine Lungenentzündung sind hohes Fieber, Atemnot, vielleicht Husten mit blutigem Auswurf. Dagegen weisen Menschen mit Bewegungseinschränkungen wie RollstuhlfahrerInnen häufig andere Symptome auf, sie haben zumeist kein Fieber, sind blass und schlapp. Beispiel Schilddrüsenerkrankung: Schilddrüsen-Erkrankungen sind bei Menschen mit Behinderung häufiger. Viele MedizinerInnen wissen dieses aber nicht, so dass es zu späten Diagnosen kommt. Behinderung ist keine Krankheit - das passt häufig nicht ins ärztliche Menschenbild.
Für Menschen mit Behinderung scheitert das Recht auf freie Arztwahl häufig aufgrund des nicht barrierefreien Zugangs zu den Praxen, der nicht verstellbaren Untersuchungsstühle, der unzureichenden schriftlichen Informationen über den Zusammenhang „Gesundheit und Behinderung“, und vieles mehr.
 Mindestanforderungen an die Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung
Mindestanforderungen an die Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung
- Es bedarf einer besseren Ausbildung aller ÄrztInnen und der übrigen Gesundheitsberufe für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
- Wir brauchen zusätzlich medizinische SpezialistInnen im Gesundheitswesen, die bei Begleiterkrankungen bei Menschen mit Behinderungen hinzugezogen werden. Es gibt diese Spezialambulanzen bereits für viele Krebserkrankte.
- Es bedarf einer besseren Koordination aller gesundheitlichen Leistungen.
- Und auch hier muss gelten: „Nichts über uns ohne uns“! ÄrztInnen müssen bestrebt sein, mit den Menschen mit Behinderung und nicht über ihren Kopf hinweg mit den Begleitpersonen zu sprechen. Sie sollten auch informiert sein über die differenzierten Formen von Zuzahlungen. Viele Menschen mit Behinderung verfügen häufig nicht über die Eigenmittel, sich jedes Heil- und Hilfsmittel leisten zu können.
Barrierefreies Gesundheitswesen
Martin Marquardt, ehemaliger Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung Berlin, fordert „Selbstbestimmt gesünder“. Als Mitglied des Arbeitskreises Barrierefreies Gesundheitswesen ist für ihn Barrierefreiheit mehr als der räumliche Zugang zu den Arztpraxen und Krankenhäusern. Das Recht auf Barrierefreiheit erfordere den Abbau der defizitären Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen!
Als Mitglied im Gesundheitsausschuss und hier Berichterstatterin für Inklusion bekräftige ich die Forderung nach einem chancengerechteren inklusiven Gesundheitswesen - insbesondere auch hinsichtlich der Verbesserung der medizinischen Ausbildung und der spezialisierten und zertifizierten Versorgungszentren. Für die unter 18-Jährigen gibt es Sozialpädiatrische Zentren. Ein vergleichbarer interdisziplinärer Ansatz ist auch für Erwachsene und für SeniorInnen geboten.
Die Einführung der Bürgerversicherung dient der gerechteren Finanzierung und der besseren Versorgung. Ein inklusives Gesundheitswesen bewirkt mehr Vielfalt, mehr Selbstbestimmung, mehr Teilhabe und Partizipation auch für PatientInnen mit Beeinträchtigungen. Ein zentrales Problem ist der Erhalt von Heil- und Hilfsmitteln. Wir brauchen auch hierfür einen vermögensunabhängigen Nachteilsausgleich. Große Bedarfe liegen weiterhin in der Assistenz, im Ausbau der Versorgungsforschung, der Stärkung der PatientInnenrechte, der Pflege. Zur Bewältigung des demographischen Wandels gehört es, verstärkt auf die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen einzugehen, unabhängig davon, ob diese „behindert“ sind aufgrund von chronischen Erkrankungen oder durch geistige, psychische und physische Beeinträchtigungen.
 Fragen und Anregungen - jeder Mensch bedarf individueller Lösungen
Fragen und Anregungen - jeder Mensch bedarf individueller Lösungen
Für die Menschen noch ohne Behinderungen sollen im Folgenden einige Bedarfsschilderungen wiedergegeben werden. Häufig ist Unkenntnis eine Ursache für Vorurteile. Menschen mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen machen häufig die Erfahrung: „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“. Sie wünschen sich von Politik und Gesellschaft, dass die Barrieren in den Köpfen der noch Nichtbehinderten abgebaut werden.
- Finanzierung des Versorgungssystems: Sind die verschiedenen Regelungen der für Menschen mit Beeinträchtigungen relevanten Sozialgesetzbücher ausfinanziert?
Antwort Mechthild Rawert: Der Sorge vor einer Unterfinanzierung wollen wir SozialdemokratInnen mit Anhebungen des Beitragssatzes von 0,5 Prozent in der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) begegnen. Um allen Menschen eine würdevolle Pflege zu ermöglichen, brauchen wir rund 6 Milliarden Euro. Wir machen auch weitreichende Vorschläge für das Leben von Menschen mit und ohne Behinderungen (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Wir wollen den Anspruch auf Hilfe zur Inklusion als Anspruch zum Ausgleich von Nachteilen ausgestalten. Finanzielle Leistungen müssen unabhängig von Einkommen und Vermögen sein. Wir wollen ein Bundesleistungsgesetz schaffen, welches die Eingliederungshilfe in der jetzigen Form abschafft. Geschätzt wird derzeitig, dass wir auf allen föderalen Ebenen, insbesondere in den Kommunen, hierzu neun Milliarden Euro benötigen. Viele benötigen auch Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch V, dem SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung. Wir SozialdemokratInnen wollen eine gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge, die den Einzelnen Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation ermöglicht.
- ExpertIn durch die Sozialversicherungsstrukturen: Eine der TeilnehmerInnen schilderte, das ihr ein Blindenhund von der Krankenversicherung versagt worden wäre mit der Bemerkung, „der wird mein Sehvermögen auch nicht wiederherstellen“.
Antwort Mechthild Rawert: Die Bemerkung seitens der Krankenkasse ist nicht nur unsensibel sondern skandalös. Das Thema Inklusion ist auch hier noch stärker zum Thema von Fortbildungen für die SachbearbeiterInnen zu machen.
- „Ein Lebenskampf - chronisch krank“ - so das Motto einiger bundesweiter Selbsthilfegruppen anlässlich des heutigen „Poliotages" in Berlin. Fakt sei: „Wer chronisch krank ist, fällt aus dem Rahmen. Er muss damit leben, nicht nur weniger zu können und anders zu sein als Gesunde, sondern auch ertragen, dass Chronisch-Krank-Sein nicht zum Stillstand kommt, kein Ende hat, wie es für eine akute Krankheit typisch ist. Das ist eine Herausforderung für die Betroffenen, aber auch für Angehörige und Ärzte.“ Auf der entsprechenden Tagung hätten die Krankenkassen versprochen, für ihre MitarbeiterInnen Schulungen zu organisieren, damit Anträge nicht „unbesehen“ von der SachbearbeiterIn abgelehnt würden.
Antwort Mechthild Rawert: Gratulation. Es ist positiv, wenn VeranstalterInnen ein positives Fazit ziehen. Ich bin gerne bereit, bei den Kassen zu einem späteren Zeitpunkt nachzufragen.
- Gesetzliche und private Krankenversicherungen: Welche Krankenversicherungsform ist denn nun am besten?
Antwort Martin Marquard: Private Krankenkassen sind für Menschen mit Behinderungen oft die schlechtere Alternative.
- Unterstützung im Alltag: Mehrere TeilnehmerInnen beschreiben, dass sie noch nicht pflegebedürftig sind, auch keine Pflegestufe haben. Was sie bräuchten ist ab und zu Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags in ihrer Wohnung.
Antwort Mechthild Rawert: Für die meisten Menschen mit und ohne Behinderungen ist die Bewältigung der eigenen Haushaltsführung vor allem im zunehmenden Alter ein Problem. Sie brauchen für einzelne Tätigkeiten hauswirtschaftliche Unterstützung. In der Gründung von kommunalen Dienstleistungszentren, die hier Unterstützung bieten können, sehe ich eine große Herausforderung bei der Bewältigung des demographischen Wandels, damit der Wunsch der Menschen, so lange wie möglich in der häuslichen Umgebung bleiben zu können, auch Wirklichkeit wird.
- Vielfalt im Gesundheitswesen Deutschlands: Eine türkischsprachige Mutter regt an, dass es auch in den Schulen AGs zum Erlernen der Gebärdensprache gibt. Die „Mutter besonderer Kinder“ regt an, dass es besonderer Unterstützungsmaßnahmen für die „besonderen Mütter“, für die Mütter besonderer Kinder bereits bei den Integrationskursen geben müsse. Es bedarf gezielter Kommunikationsmaßnahmen: Es geht um Deutschunterricht besonders für Mütter behinderter Kinder. Sie kenne Mütter von gehörlosen Kindern, die aus der Türkei kommend hier anfangs kein Deutsch lernen konnten. Die Mutter kann keine Gebärdensprache, das Kind spreche die Lippensprache auf deutsch.
Antwort Mechthild Rawert: Ich bin dankbar für den Hinweis auf diese „doppelte Sprachlosigkeit“. Ich nehme die Anregungen auf, eine Lösung habe ich jetzt aber auch noch nicht. Ich hoffe, dass in Berlin sehr schnell sehr viele inklusive Schulen existieren.
- GebärdendolmetscherInnen sind überall von Nöten. Beispiel: Ich selber kann sprechen und bin taub. Mein Sohn hat Lernschwierigkeiten, hat eine sogenannte geistige Behinderung. Nun möchte er, dass ich mit ihm zum Arzt gehe, dafür brauche ich aber eine GebärdensprachdolmetscherIn, um den Arzt zu verstehen, um ihn zu fragen, um das Beste für meinen Sohn rausholen. Was ist zu tun?
 Antwort Jeanne Nicklas-Faust: Für gehörlose Eltern hörender Kinder gab es lange Zeit auch keine GebärdensprachdolmetscherInnen. Für gehörlose Eltern wurde nach langen Debatten für schulische Belange, z.B. beim Elternabend, eine Assistenz erkämpft. Deren Bezahlung wurde durch eine Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes ermöglicht. Hier wäre Paralleles für das Gesundheitswesen zu überlegen, schließlich ist die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten von herausragender Bedeutung.
Antwort Jeanne Nicklas-Faust: Für gehörlose Eltern hörender Kinder gab es lange Zeit auch keine GebärdensprachdolmetscherInnen. Für gehörlose Eltern wurde nach langen Debatten für schulische Belange, z.B. beim Elternabend, eine Assistenz erkämpft. Deren Bezahlung wurde durch eine Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes ermöglicht. Hier wäre Paralleles für das Gesundheitswesen zu überlegen, schließlich ist die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten von herausragender Bedeutung.
Nachfrage: Nach dem Arztbesuch muss ich aber zur Apotheke. Was mache ich dort?
- Merkzeichen für taubblinde Menschen im Schwerbehindertenausweis: Wann kommt es zu einem eigenen Merkzeichen für taubblinde Menschen?
Antwort Mechthild Rawert: Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat unseren Antrag „Taubblindheit als Behinderung eigener Art anerkennen - Merkzeichen Taubblindheit einführen“ im Juni abgelehnt. Somit kann die Umsetzung des einstimmigen Beschlusses der Arbeits- und Sozialministerkonferenz von November 2012 frühestens in der nächsten Legislaturperiode erfolgen. Ich bedauere diese Ablehnung sehr, da Taubblinden damit eine sichtbare Anerkennung ihrer Behinderung und damit auch weiterhin das Recht auf bestimmte Nachteilsausgleiche oder Sozialleistungen fehlt.
- Bürgerschaftliches Engagement: Ein Mann schildert, dass er bis an die Taubheit grenzend schwerhörig sei. Während des aktiven Erwerbslebens sei er im Förderverein der Gehörlosen gewesen. Als Rentner könne der die notwendigen 3000 Euro pro Ohr, die bessere Hörgeräte kosten, nicht bezahlen. Diese werden von der Krankenkasse aber abgelehnt. Es müsse aber auch beeinträchtigten Rentnern ein aktives Seniorenleben möglich sein.
Antwort Mechthild Rawert: Die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in alle Strukturen des zivilgesellschaftlichen Engagements ist auch eine der großen Herausforderungen. Ich werde einmal bei entsprechenden Organisationen nachfragen, welche Konzepte und Lösungsansätze hierzu existieren.
- Wohnortnahe Gesundheitsversorgung verbessern: Eine Teilnehmerin beklagt den Facharztmangel im Bezirk Köpenick. Dieser sei besonders schlimm für psychisch erkrankte Menschen. Das dortige Krankenhaus sei mit sehr guten Geräten auf neuestem Stand ausgerüstet. Davon habe auch sie als Mensch mit Behinderung während ihrer stationären Behandlung profitiert. Außerdem seien bis vor zwei Jahren dort auch ambulante Behandlungen möglich gewesen. Nun müsse sie durch die halbe Stadt fahren, um an vernünftige barrierefreie Untersuchungen zu gelangen. Warum ist das so? MedizinerInnen hätten doch einen Eid abgelegt, um Menschen zu helfen.
Antwort Jeanne Nicklas-Faust: Es gibt keinen ärztlichen Eid mehr sondern eine ärztliche Berufsordnung. Nach dieser muss jede ÄrztIn hilfebedürftige PatientInnen behandeln. Keine ÄrztIn kann aber gezwungen werden, über eine bestimmte Anzahl von PatientInnen hinaus, weitere aufzunehmen. Eine eigentlich gute Regelung, da jeder Patient genug Zeit erhalten müsse. Richtig ist, dass viele ÄrztInnen gar nicht wollen, dass Menschen erfahren, dass sie eine barrierefreie Praxis haben. Hier fehlen zusätzliche Regelungen in der ärztlichen Vergütungsordnung. Wir haben in Deutschland eine zu starre Trennung des ambulanten und stationären Sektors. Das erwähnte Krankenhaus habe sicherlich eine Extra-Ermächtigung zur Durchführung ambulanter Leistungen gehabt. Diese gibt es aber nicht, wenn genügend ambulante Praxen vor Ort vorhanden sind. Die Kliniken würden dieses Angebot von sich aus gerne aufrechterhalten.
- Mehr Respekt seitens der ÄrntInnen eingefordert: Ein mehrfach behinderter Mann mit einer Lähmung auch beim Sprechen beklagt sich über mangelnden Respekt seitens der MedizinerInnen. Warum ist das so?
Antwort Jeanne Nicklas-Faust: „Weil die Ärzte selber zu blöd sind das zu erkennen!“. Auch ÄrztInnen schlussfolgern häufig vorschnell, dass durch eine Lähmung ausgelöste Sprachschwierigkeiten etwas mit Intelligenz zu tun hätten. Dem ist nicht so, hier bedarf es dringender Aufklärungsmaßnahmen.
- Barrierefreiheit für Arztpraxen, Ärztehäuser, Medizinische Versorgungszentren: Wer kontrolliert die einzelnen Maßnahmen zur Barrierefreiheit? Auch in neuen Häusern sind die Aufzüge häufig zu klein. Wie sieht die entsprechende Bauvorschrift und deren Kontrolle aus?
 Antwort Martin Marquard: Gerade im Baubereich hat es in den vergangenen Jahren eine starke Deregulierung gegeben, die dazu geführt habe, dass zunehmend mehr Kontrollen abgeschafft wurden. Der Bauherr bzw. der Architekt trägt die Verantwortung. Sollten bei einem Neubau Vorschriften zur Barrierefreiheit nicht eingehalten werden, ist entweder das Bezirksamt, zum Beispiel die Behindertenbeauftragte, oder die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die anzugehende Beschwerdestelle. Beim Altbau gibt es Bestandsschutz. Allerdings kann jede ÄrztIn, jede PhysiotherapeutIn aus eigenem Interesse mit den Eigentürmern oder Wohnungsbaugesellschaften zur Herstellung von Barrierefreiheit reden. Grundsätzlich bestehe in der Landessbauordnung von 2006 noch viel Änderungsbedarf insbesondere bei den Bestimmungen zur Barrierefreiheit. Er selber plädiere für die neue landesweite Funktion Bausachverständige/r für Barrierefreiheit.
Antwort Martin Marquard: Gerade im Baubereich hat es in den vergangenen Jahren eine starke Deregulierung gegeben, die dazu geführt habe, dass zunehmend mehr Kontrollen abgeschafft wurden. Der Bauherr bzw. der Architekt trägt die Verantwortung. Sollten bei einem Neubau Vorschriften zur Barrierefreiheit nicht eingehalten werden, ist entweder das Bezirksamt, zum Beispiel die Behindertenbeauftragte, oder die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die anzugehende Beschwerdestelle. Beim Altbau gibt es Bestandsschutz. Allerdings kann jede ÄrztIn, jede PhysiotherapeutIn aus eigenem Interesse mit den Eigentürmern oder Wohnungsbaugesellschaften zur Herstellung von Barrierefreiheit reden. Grundsätzlich bestehe in der Landessbauordnung von 2006 noch viel Änderungsbedarf insbesondere bei den Bestimmungen zur Barrierefreiheit. Er selber plädiere für die neue landesweite Funktion Bausachverständige/r für Barrierefreiheit.
- Mehr Kooperationen im Interesse des einzelnen Menschen über Sozialgesetzbücher hinweg: Die Mutter einer schwerst mehrfach behinderten Tochter beklagte die unzureichende Information und Einbeziehung bei gesundheitlichen Entscheidungen „im Namen meiner Tochter“. Ursache sei nicht nur eine mangelhaft ausgeprägte Zusammenarbeit innerhalb des Gesundheitswesen sondern auch die rechtliche Situation: Ständig würde die „gesetzliche Betreuung - diese läge bei ihr - und die Betreuung durch Fachkräfte in den Einrichtungen verwechselt.
- Barrierefreies Wohnen: Auf die Notwendigkeit barrierefreien Wohnens und die Ermöglichung eines solchen wurde von mehreren TeilnehmerInnen hingewiesen.
Antwort Mechthild Rawert: Im Konzept der SPD-Bundestagsfraktion „Für eine umfassende Pflegereform: Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe stärken“ sind auch Vorschläge zur Finanzierung barrierefreien Wohnens gemacht worden. Barrierefreies Wohnen und die Berücksichtigung der Sozialraumorientierung sind Grundvoraussetzungen für „ambulant vor stationär“.
- Gegenseitiges Zuhören und notwendiger Dialog: Für Menschen mit und ohne Behinderung ist der Slogan „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“ von großer Bedeutung. Viele gehören zu denen, die noch nicht behindert, noch nicht beeinträchtigt sind. Wichtig sei, sich gegenseitig mitzuteilen, was mensch möchte bzw. dass auch Unsicherheiten vorliegen. „Ich weiß oft nicht, soll ich Hilfe anbieten oder beschränke ich da jemanden in der Selbstbestimmung?“. Die Teilnehmerin, eine junge Frage, hat es sich angewöhnt zu fragen „Kann ich ihnen helfen?“
- Mentale Barrieren in den Gesundheitsberufen: Warum haben so viele einen Gesundheitsberuf ausübenden Menschen Vorurteile hinsichtlich Menschen mit Behinderungen?
Antwort Mechthild Rawert: Ich glaube nicht, dass die Vorurteile hier stärker sind. Unsere Aufgabe ist allerdings: Vorurteile müssen abgebaut werden. Es handelt sich schließlich um ein professionelles Versorgungssystem. In den Ausbildungen fehlen häufig noch entsprechende Module, gleiches gilt für Fort- und Weiterbildungen.
- Kooperation zwischen den Gesundheitsberufen: Die Vertreterin des Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V. fordert eine stärkere Kooperation der Gesundheitsberufe untereinander, denn medizinische Versorgung sei Teamarbeit. Das Verhältnis zwischen den ÄrztInnen und anderen Gesundheitsberufen sei neu zu justieren.
Antwort Mechthild Rawert: Zu Recht werden hier im Gesundheitsausschuss schon angesprochene Herausforderungen u.a. Delegation / Substitution oder auch die berufsfachlichen bzw. akademischen Ausbildungsstrukturen, die Anerkennung der Berufe in Europa, und vieles mehr angesprochen. Da ich selber Berichterstatterin für Gesundheitsberufe bin, bitte ich um Übersendung des genauen Forderungskataloges. Es geht auch über die Honorarverteilung in einem am Wohl der PatientInnen und Beschäftigten orientiertem Gesundheitswesen. Hier sind noch einige Stellschrauben zu drehen. Über ein künftiges Gespräch würde ich mich freuen.
Karin Sarantis-Aridas ermunterte dazu, weitere Lösungen in Zusammenarbeit mit der AG Selbst Aktiv Berlin zu erarbeiten. Über dieses aktive politische Engagement freue ich mich. Denn eines ist klar: Gesellschaft muss häufig noch lernen wo und wie Inklusion zu erfolgen hat. Packen wir es an! Gemeinsam!