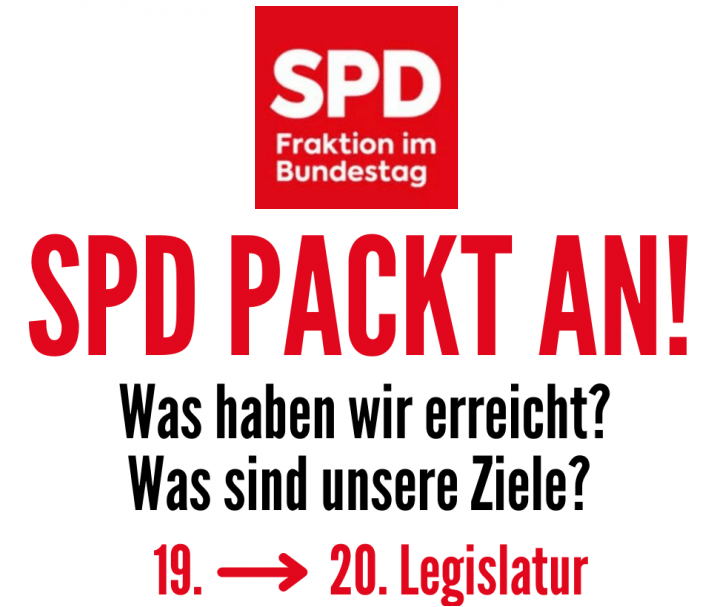Kunst und Politik im Reichstagsgebäude
„Kunst und Politik“, Kunst und Geschichte gehören zusammen - das wurde auch bei meiner zweiten Kunst- und Architekturführung in diesem Jahr am 27. April 2014 deutlich. Mal wieder mein höchstes Lob nicht nur an die TeilnehmerInnen an diesem sonntäglichen Event sondern auch an den Besucherdienst, in diesem Falle konkret Herrn Wagner. Spannend auch die Diskussionen im SPD-Fraktionssaal zu aktuellen politischen Themen. Den Abschluss bildete der Besuch der Kuppel.
Kunst am Bau
„Die Geschichte der Kunst am Bau in Deutschland“ hat mit der demokratischen Entwicklung unseres Staates zu tun. Mich freuen die Aussagen von Herrn Wagner, dass die SPD hier bereits in der Weimarer Republik eine treibende Rolle gespielt hat. Am 20. Juni 1928 wurde ein Runderlass herausgegeben, nach dem Künstler bei öffentlichen Bauten zu beteiligen sind. Dieser Runderlass wurde selbst von den Nazis übernommen und gewann in überarbeiteter Form an Bedeutung in beiden deutschen Staaten. Die Freiheit der Kunst wurde in Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben. Angesichts der Not nach 1945 war der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 25. Januar 1950 zur Aufwendung eines Teils der Bausumme öffentlicher Bauten für Kunst aufzuwenden, beeindruckend. Das Parlament beschloss, „die bildende Kunst zu fördern“ und bei allen Bauaufträgen des Bundes grundsätzlich einen Betrag von mindestens einem Prozent der Bausumme für Werke bildender Künstler vorzusehen. Damit war gewährleistet, dass Kunst dorthin kommt, wo Menschen sind, denn Kunst hat eine Kraft, die eine ganze Gesellschaft sensibilisieren kann. Dieser Betrag wurde später noch erhöht. Fortan gab es sowohl viele Diskussionen zur Idee der „Kunst im öffentlichen Raum“ als auch zur „Kunst am Bau“. Hierbei wurden die Künstler durch fachkundige Jurys ausgewählt und frühzeitig in die Bauplanungen einbezogen, ihre Werke konnten sich so als eigenständiges Pendant zur Architektur behaupten. Der Bundestagsbeschluss vom 20. Juni 1991, Berlin zur Hauptstadt zu machen und mit Parlament und großen Teilen der Regierung vom Rhein an due Spree zu ziehen, gab auch der Kunst am Bau enorme Impulse“ („Aktueller Begriff Kunst am Bau“). Gerade in Zeiten öffentlicher Sparmaßnahmen ist eine bindende Verpflichtung auch Zeichen der Wahrnehmung von kulturpolitischer Verantwortung.
Seit 1995 existiert der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages, der die BundespräsidentIn in Fragen der Förderung der bildenden Kunst berät. Vorläuferorganisation war die 1979 von Annemarie Renger (SPD) gegründete Kunstkommission. Die Mitglieder des Kunstbeirates sind ParlamentarierInnen, die die BundestagspräsidentIn in Fragen der Förderung der bildenden Kunst in drei Aufgabenfeldern beraten: beim Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, bei der Entwicklung von Kunst-am-Bau-Konzepten für die Parlamentsbauten in Berlin sowie hinsichtlich der Ausstellungen zeitgenössischer Kunst für den Kunst-Raum des Deutschen Bundestages im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus.Intensive Diskussionen gab es jeweils zu den Kunstwerken „Tisch mit Aggregat“ von Joseph Beuys in der unmittelbaren Nähe des Parlamentssaales, zu den in der Westhalle hängenden Arbeiten von Sigmar Polke und von Gerhard Richter, zu den im Clubraum hängenden wie in einer Ikonenwand aufgereihten 115 Einzelbilder, in denen der russischstämmige Künstler Grischa Bruskin einige der Mythen der Sowjetunion ironisiert. Auf großes Interesse stießen die Ausführungen zu Günter Ueckers Gestaltung des Andachtsraum und zu Hans Haackes Installation "DER BEVÖLKERUNG". Über das Kunstwerk „Der Bevölkerung“ hatte nicht nur der Kunstbeirat, sondern sogar das Plenum des Deutschen Bundestages entschieden. Berührend waren die Informationen zum fünfteiligen Fotogemälde der Künstlerin Katharina Sieverding, welches mit dem Motiv der lodernden Sonnenkorona Assoziationen sowohl an den Reichstagsbrand und den von den Nationalsozialisten ausgelösten Weltenbrand als auch an die geläuterte Wiedergeburt des demokratischen Deutschland als "Phoenix aus der Asche" weckt. Die auf den Tischen vor dem Gemälde liegenden Gedenkbücher würdigen die Schicksale der einzelnen verfolgten Abgeordneten.