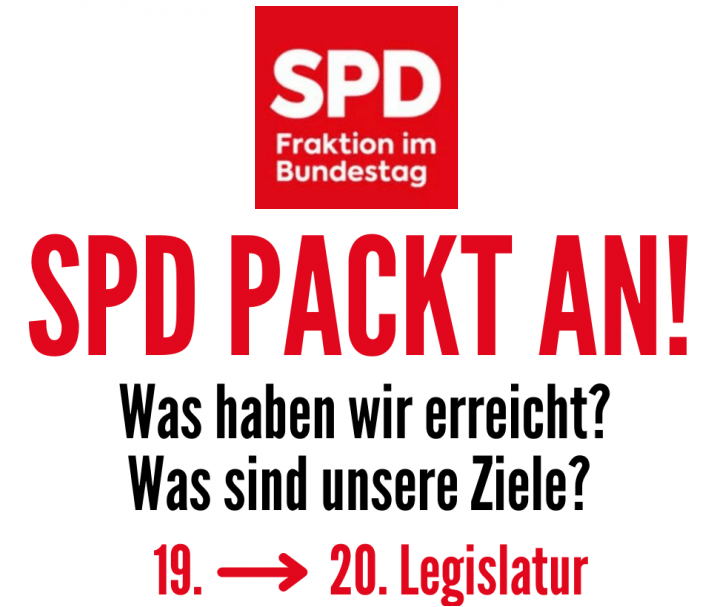Im Bundestag
„Besatzungskinder“ - Vater gesucht!
28 Oktober, 2013 - 15:24 Die Frage „Wo komme ich her?“ bewegt alle Menschen und ist Teil der lebenslangen Frage „Wer bin ich?“. Für viele Menschen ist die Frage nach der Herkunft leicht zu beantworten, da Mutter und Vater bekannt sind.
Die Frage „Wo komme ich her?“ bewegt alle Menschen und ist Teil der lebenslangen Frage „Wer bin ich?“. Für viele Menschen ist die Frage nach der Herkunft leicht zu beantworten, da Mutter und Vater bekannt sind.
Anders ist es bei den über 200.000 Menschen in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Kinder aus Verbindungen deutscher Frauen mit russischen, britischen, französischen und US-amerikanischen „Besatzungssoldaten“ zur Welt kamen. Auf der Geburtsurkunde dieser „Besatzungskinder“ steht zumeist „Vater unbekannt“. Nicht immer waren die Bedingungen des Aufwachsens für sie leicht: rund 70 Prozent der Kinder wuchsen bei ihren Müttern auf, rund 30 Prozent in einem Heim. Die Betroffenen haben die Wahrheit über ihren Vater häufig erst spät erfahren. Das Schweigen in den Familien und der Gesellschaft war groß. Hoch sind auch die Hürden, die Väter zu finden: Mal sind deren Unterlagen längst vernichtet, mal verzweifeln die Soldatenkinder an bürokratischen Vorschriften, mal werden sie von dubiosen Suchdiensten über den Tisch gezogen.
Starke Frauen gibt es weltweit!
25 Oktober, 2013 - 10:42 „Frauen müssen nach der Macht greifen wollen“ - so dass gemeinsame Fazit von frauenpolitischen Aktivistinnen von der Elfenbeinküste, aus Guinea, Benin, Senegal, Kamerun, Ruanda, Tschad und Niger und mir am Ende unserer Diskussion im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Diese Frauen sind wahrlich Aktivistinnen - unter ihnen eine Ministerin, eine Direktorin des Staatsfernsehens, eine Chefredakteurin und eine Journalistin, mehrere Parlamentarierinnen u.a. in der Gesundheitspolitik, Bundesvorsitzende von Mädchen- und Frauenorganisationen und Menschenrechtsaktivistinnen - und sie wundern sich, dass auch in einem „entwickelten Land“ wie Deutschland die Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit nicht zufriedenstellend umgesetzt sind.
„Frauen müssen nach der Macht greifen wollen“ - so dass gemeinsame Fazit von frauenpolitischen Aktivistinnen von der Elfenbeinküste, aus Guinea, Benin, Senegal, Kamerun, Ruanda, Tschad und Niger und mir am Ende unserer Diskussion im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Diese Frauen sind wahrlich Aktivistinnen - unter ihnen eine Ministerin, eine Direktorin des Staatsfernsehens, eine Chefredakteurin und eine Journalistin, mehrere Parlamentarierinnen u.a. in der Gesundheitspolitik, Bundesvorsitzende von Mädchen- und Frauenorganisationen und Menschenrechtsaktivistinnen - und sie wundern sich, dass auch in einem „entwickelten Land“ wie Deutschland die Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit nicht zufriedenstellend umgesetzt sind.
Beginn meines Freiwilligen Sozialen Jahres im Abgeordnetenbüro von Mechthild Rawert
18 Oktober, 2013 - 13:38 Mein Name ist Tonia Botzenhardt, ich bin 18 Jahre alt und habe im Juni dieses Jahres das Askanische Gymnasium in Berlin-Tempelhof mit der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen.
Mein Name ist Tonia Botzenhardt, ich bin 18 Jahre alt und habe im Juni dieses Jahres das Askanische Gymnasium in Berlin-Tempelhof mit der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen.
Nach langem Warten und einem spannenden Wahlkampf fing ich am 1. Oktober mein Freiwilliges Soziales Jahr in der Politik (FSJ-P) im Abgeordnetenbüro von Mechthild Rawert an.
Was ist ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Politik?
Das FSJ-Politik findet in der Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) in Berlin statt.
Gedenkstättenfahrt der Berliner SPD nach Krakau und Auschwitz vom 23. bis 25. November 2013
27 September, 2013 - 15:10In langjähriger Tradition veranstaltet die Berliner SPD Gedenkstättenfahrten. Anlässlich des 75. Jahrestages der Novemberpogrome findet vom 23. bis 25. November 2013 eine Bildungsreise nach Krakau und Auschwitz statt. Auf diese Fahrt mache ich Sie gern aufmerksam. "Auschwitz" steht geradezu als Chiffre für den Holocaust.
Die SPD-Bundestagsfraktion ist größer, weiblicher und vielfältiger
25 September, 2013 - 17:21 Ich freue mich, dass die SPD-Bundestagsfraktion größer, weiblicher und vielfältiger geworden ist. Von den 192 SPD-Abgeordneten sind 81 Frauen. Das sind über 42 Prozent! Damit wird deutlich: Bei der SPD ist die Gleichstellung von Frauen und Männern kein leeres Versprechen. Neun SPD-Abgeordnete haben eine Migrationsbiografie.
Ich freue mich, dass die SPD-Bundestagsfraktion größer, weiblicher und vielfältiger geworden ist. Von den 192 SPD-Abgeordneten sind 81 Frauen. Das sind über 42 Prozent! Damit wird deutlich: Bei der SPD ist die Gleichstellung von Frauen und Männern kein leeres Versprechen. Neun SPD-Abgeordnete haben eine Migrationsbiografie.
Ich danke meinen Genossinnen und Genossen für einen tollen Wahlkampf! Als Berliner SPD haben wir gewonnen - und das ist gut so! Insgesamt ziehen 8 Abgeordnete für die SPD Berlin in den Bundestag: Fritz Felgentreu (Neukölln), Ute Finckh (Steglitz-Zehlendorf), Eva Högl (Mitte), Cansel Kizitepe (Friedrichshain-Kreuzberg), Klaus Mindrup (Pankow), Mechthild Rawert (Tempelhof-Schöneberg), Matthias Schmidt (Treptow-Köpenick) und Swen Schulz (Spandau). Acht starke Stimmen für soziale Gerechtigkeit! Ich bedauere, dass Erik Gührs (Lichtenberg), Ülker Radziwill (Charlottenburg-Wilmersdorf), Iris Spranger (Marzahn-Hellersdorf) und Jörg Stroedter (Reinickendorf) nicht mit uns einziehen können.